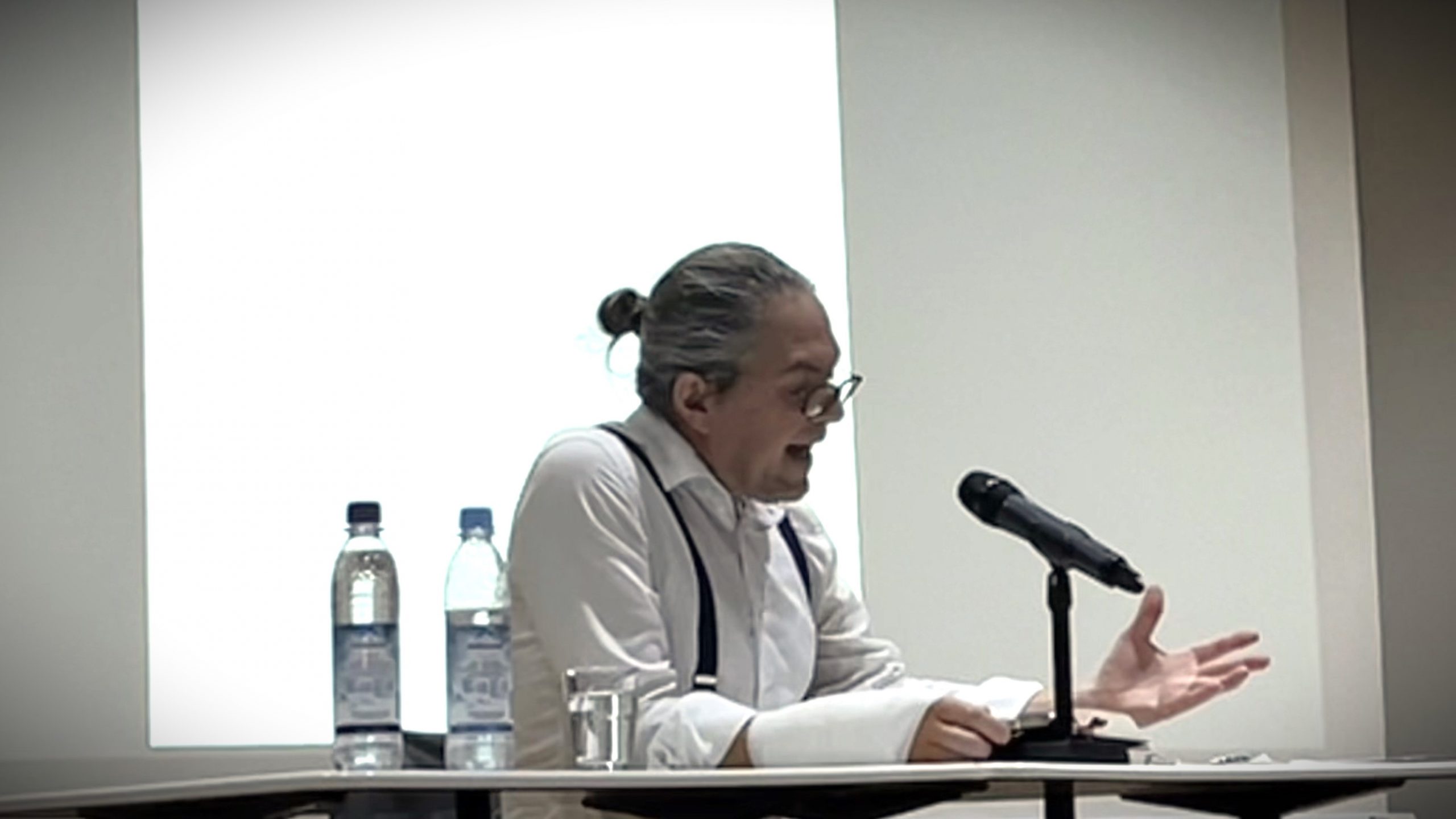Aktuelles
Gedenkstättenbesuch der 9. Jahrgangsstufe
Die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau besuchte die neunte Jahrgangsstufe im Rahmen des Geschichtsunterrichts. Mit dem Besuch der Ausstellungsräume und einer fachkundigen Führung über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers hatten die Schülerinnen und Schüler vor Ort Gelegenheit zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dessen menschenverachtendem Charakter.
Text: Sonja Schmidmayr
Foto: Sabrina Haupt
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
Aus „Arthur und Lilly – das Mädchen und der Holocaust-Überlebende“ las die Historikerin Lilly Maier am 26. Januar für die 9. Jahrgangsstufe. Die Veranstaltung erinnerte am Vortag des offiziellen Gedenktages an den Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Lilly Maier war auf Einladung der Fachschaften Geschichte und Religion zu Gast.
Unter musikalischer Umrahmung von Emily Stark am Cello und Marie-Therese Daubner am Klavier stellten in einer kurzen Einführung Schülerinnen der 9. Klasse die Frage nach dem Sinn von Gedenken. In ihrer Antwort zitierten sie den ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der die erste Rede zum damals neu geschaffenen Gedenktag 1996 im Bundestag gehalten hatte: „Geschichte verblasst schnell, wenn sie nicht Teil des eigenen Erlebens war. Deshalb geht es darum, aus der Erinnerung immer wieder lebendige Zukunft werden zu lassen.“ Es gehe darum, junge Menschen zu erreichen und ihren Blick zu schärfen, woran man Rassismus und Totalitarismus in den Anfängen erkennt, denn es komme auf die rechtzeitige Gegenwehr an, darauf, „nicht erst aktiv zu werden, wenn sich die Schlinge schon um den eigenen Hals legt“.
Daran anknüpfend las die Historikerin Lilly Maier aus ihrem Buch „Arthur und Lilly – das Mädchen und der Holocaust-Überlebende“. Es geht darin um die Geschichte von Arthur Kern, der in Wien aufwuchs und damals noch Oswald Kernberg hieß. 1938, mit 10 Jahren, wurde er allein, ohne seine Familie, über einen Kindertransport zunächst nach Frankreich, später weiter nach Amerika gerettet. Als einziger seiner Familie hat er den Holocaust überlebt. Durch die Wohnung in Wien, in der beide im Abstand von Jahrzehnten gelebt haben, lernten sich Lilly Maier und Arthur Kern kennen, sodass auch der Einfluss dieser Begegnung auf beide eine Rolle im Buch spielt. Lilly Maier gelang es, ihre biographische Herangehensweise anschaulich mit historischen Fakten zu verknüpfen und auch durch ihre unpathetische Art der Darstellung die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen auf diese Reise in eine schlimme Vergangenheit. Sichtlich beeindruckt von der Lebensgeschichte Arthur Kerns nahmen die Jugendlichen im Anschluss die Gelegenheit wahr, Fragen zu stellen.
In Kooperation mit der Buchhandlung WortReich fand dort am Abend eine weitere Lesung von Lilly Maier für die Öffentlichkeit statt. Sie stellte dort ihr jüngstes Buch „Auf Wiedersehen, Kinder“ über den österreichischen Reformpädagogen Ernst Papanek, der das Heim für die geflüchteten Kinder in Frankreich betreut hat, vor zahlreichem interessiertem Publikum vor.
Text: Sonja Schmidmayr
Bild: Sonja Schmidmayr
Steffen Kopetzky liest für die 11. Jahrgangsstufe
Wie wird aus Geschichte ein Roman? Dieser Frage konnten die Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe nachgehen, als auf Einladung der Fachschaft Geschichte der renommierte Schriftsteller Steffen Kopetzky zu Gast am Schyren-Gymnasium war und aus seinem jüngsten Roman ‚Damenopfer‘ las.
Kopetzky, dem Schyren-Gymnasium als ehemaliger Schüler und Schülervater eng verbunden, ist erfolgreicher Autor von Romanen, die genauestens recherchierten historischen Hintergrund mit Fiktion verbinden, und stand mit ‚Risiko‘ und ‚Monschau‘ monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Auch ‚Damenopfer‘ fügt sich in diese Reihe ein und ist angesiedelt in der Zwischenkriegszeit des vergangenen Jahrhunderts. Erzählt wird die Geschichte von Larissa Reissner, in Deutschland und Russland aufgewachsen, Schriftstellerin, Revolutionärin, gebildet und charismatisch, und um ihre Verstrickungen in weltrevolutionäre Pläne der Zeit.
In diesen komplizierten Hintergrund und die historischen Zusammenhänge führte Kopetzky die Schülerinnen und Schüler mit einer Rückschau auf seinen Roman ‚Risiko‘ geschickt ein und erläuterte anschaulich die Verbindungen, die sich auch, aber nicht nur beim Personal der Romane zeigen, bevor er sie mitnahm auf eine fesselnde Zeitreise in die Welt der Larissa Reissner. Die Ausschnitte, die Kopetzky mitreißend vortrug, ließen diese vergangene Welt in farbigen Bildern wieder auferstehen, machten aber auch historische Zusammenhänge deutlich und zeigten, dass diese bis in die Gegenwart reichen können.
Im Anschluss an die Lesung nutzten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit und stellten insbesondere Fragen zur Rezeption von Geschichte, zur Recherche des historischen Hintergrunds und zu den Problemen, die sich bei der Verwandlung historischer Figuren in Romanfiguren ergeben.
Text: Sonja Schmidmayr und Simon Gadringer
Foto: Deborah Költzsch
Die Nachgeborenen von Hiroshima
Die japanische Autorin Shaw Kuzki, 1957 in Hiroshima geboren, hat am 19. Juli an unserer Schule ihren Erzählband „Die schwimmenden Laternen von Hiroshima“ vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler zweier neunter Klassen stellten nicht nur interessierte Fragen zur literarischen Verarbeitung des Atombombenangriffs, sondern hatten auch Gelegenheit, Interessantes über das Erlernen der japanische Sprache zu erfahren.
Shaw Kuzki gehört zur Nachfolgegeneration der Überlebenden des 6. August 1945 und arbeitete als Englisch-Dozentin in Japan. Seit ihrem Debüt im Jahre 2005 zählt sie zu Japans wichtigsten und erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Viele Geschichten von Shaw Kuzki lassen sich der sogenannten Atombombenliteratur zuordnen, so auch ihr Werk, das die Grundlage der Lesung bildet und somit auch einen Anknüpfungspunkt zum Fach Geschichte hat. Im Mittelpunkt einer ihrer Erzählungen steht das bleibende Schuldgefühl jener, die keine Gelegenheit hatten, sich von den späteren Atombombenopfern respektvoll zu verabschieden, da sie die Katastrophe nicht kommen sahen.
Shaw Kuzki ist aber auch Fantasy-Schriftstellerin und zeigte sich als Katzen-Liebhaberin. Die Veranstaltung moderierte Gregor Wakounig, Japanologe, Übersetzer und freier Journalist. Die Texte in deutscher Sprache wurden von der Schauspielerin Dascha von Waberer gelesen. Die Veranstaltung war Teil des ‚White Ravens‘-Literaturfestivals, das Jugendliteratur an die Schulen bringt. Sie wurde von Geschichte-Fachschaftsleiterin Sonja Schmidmayr an unsere Schule geholt – und live an die Amanuma Junior High School, Sugihami (Tokyo) übertragen.

Text: Roland Scheerer
Foto: Sonja Schmidmayr
Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Dachau (Jgst. 9 und 11)
Nirgendwo zeigt sich Erinnerung eindrucksvoller als an einem historischen Ort, an dem Platz, an dem sich das abspielte, was die Erinnerung bestimmt. Daher begaben sich die Schülerinnen und Schüler der 9. und 11. Jahrgangsstufe mit ihren Geschichtslehrerinnen und -lehrern im Juni in die KZ-Gedenkstätte nach Dachau. Das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers ist einer jener Orte, der durch das Vergangene bestimmt wird und so Ansätze für das Verstehen des Unvorstellbaren bietet.
Das Dachauer Konzentrationslager, errichtet am 22. März 1933 auf dem Areal der stillgelegten Königlichen Pulver- und Munitionsfabrik, hatte die zwölf Jahre des nationalsozialistischen Regimes Bestand und diente als Musterlager. Mehr als 200.000 Gefangene aus über 40 Nationen waren im KZ Dachau und seinen Außenlagern inhaftiert, mindestens 41.500 Menschen starben dort. Am 29. April 1945 wurde das Konzentrationslager Dachau durch Einheiten der US-Armee befreit. Dank der Initiative der Überlebenden konnte 1965 auf dem ehemaligen Häftlingslager eine Gedenkstätte mit Dokumentarausstellung errichtet werden. Eine dreistündige Führung ermöglichte den Schülerinnen und Schülern beider Jahrgänge historisches Lernen, da die Gedenkstätte eine sachliche Aufklärung durch Dokumente leistet, aktuelle Bezüge zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellt und Möglichkeiten emotionalen und kognitiven Lernens eröffnet.

Text und Bild: Sabrina Haupt
Fachprofil Geschichte
Was hat es mit dem „Hungerturm“ in Pfaffenhofen auf sich? Warum gibt es in Bayern so viele Schlösser? Warum ist am 03. Oktober Nationalfeiertag? – Immer wieder berühren Fragen der Vergangenheit unsere Gegenwart. Schüler für Vergangenes zu interessieren und sie ihnen nahezubringen ist Ziel des Geschichtsunterrichts. Dabei geht es aber stets auch um die Gegenwart, darum, sich in ihr zu orientieren, um die Zukunft mitgestalten zu können. Auch deshalb gilt Geschichte als eines der Leitfächer für politische Bildung.
Das Fach Geschichte wird am Gymnasium durchgehend von der 6. Jahrgangsstufe bis zum Abitur unterrichtet.
Gemäß dem aktuell nur noch für die Jahrgangsstufen 10-12 gültigen Lehrplan wird dabei bis zum Ende der Mittelstufe chronologisch vorgegangen, in der Qualifikationsphase vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen durch historische Längs- und Querschnitte. Zusätzlich können sie ein W- oder P-Seminar wählen.
Auch der LehrplanPlus, der für die Jahrgangsstufen 6-9 bereits gültig ist, sieht ein vorwiegend chronologisches Vorgehen in Unter- und Mittelstufe vor, durchbrochen von mehreren thematischen Längsschnitten. Diese dienen einerseits der methodischen und inhaltlichen Vertiefung, im Sinne nachhaltigen Lernens aber auch der Festigung grundlegender Daten und Begriffe. In der Oberstufe wird auch künftig vom chronologischen Lernen abgewichen. So bietet beispielsweise die Jahrgangsstufe 11 den Schülerinnen und Schülern in ihrer Funktion als „Gelenkklasse“ hin zur Oberstufe mit zwei Längsschnitten einen Einblick in gegenwärtige historische Diskurse. Das Fach Geschichte ist auch künftig Pflichtfach bis zum Abitur und wird sowohl im Seminarbereich der Oberstufe und als auch als Leistungsfach mit erhöhtem Niveau wählbar sein.
Nicht erst mit der Einführung des LehrplanPlus – seither aber besonders – steht im Geschichtsunterricht der Erwerb von Kompetenzen im Fokus. Vor dem Hintergrund historischen Lernens üben die Schülerinnen und Schüler das fachspezifische Herangehen an Geschichte und den Umgang mit verschiedensten analogen und digitalen Materialien ein. Noch stärker als bisher rücken neben der kritischen Analyse auch und gerade im digitalen Bereich Anwendungsbezug und Gegenwartsorientierung in den Vordergrund, sodass die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen über das konkrete Fach hinaus erwerben.
Historisches Lernen spielt sich natürlich im Klassenzimmer ab – aber auch außerhalb, wie die Aktivitäten der Fachschaft Geschichte zeigen:
Schon seit einigen Jahren können die Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe „echte Römer“ erleben. Beim Römerprojekt erfahren sie nicht nur Interessantes über Ausrüstung, Bewaffnung und Leben der römischen Soldaten, sondern dürfen auch selbst ausprobieren, wie es sich beispielsweise angefühlt hat, ein Kettenhemd zu tragen oder in genagelten Schuhen zu gehen.
Alternativ dazu hat sich zum Beginn der 6. Jahrgangsstufe das Steinzeitprojekt des „Grünen Klassenzimmers“ etabliert, das den Schülerinnen und Schülern das Leben in der Steinzeit anschaulich und handlungsorientiert nahebringt und sie in das „neue Fach“ einführt.
In der 7. und 8. Jahrgangsstufe gibt es kein verbindliches „Programm“, der Lehrplan bietet aber zahlreiche Anknüpfungspunkte, um von den Lehrkräften individuell organisierte Exkursionen zu unternehmen. So führen beispielsweise die Lehrplaninhalte zu Geschichte und Architektur der mittelalterlichen Stadt in Jahrgangsstufe 7 oder die Frage nach der Bedeutung des Denkmalschutzes in Jahrgangsstufe 8 immer wieder zu Stadtspaziergängen in die eigene Umgebung, der 1. Weltkrieg ins Armeemuseum nach Ingolstadt und vieles mehr.
In der 9. Jahrgangsstufe wird den Schülerinnen und Schülern mit einer Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Dachau Gelegenheit gegeben, sich intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.
Immer wieder konnten in den vergangenen Jahren Schülerinnen und Schüler beim Zeitzeugengespräch mit Herrn Abba Naor einen Überlebenden des Holocaust treffen und am Beispiel seines Schicksals in sehr persönlicher und unmittelbarer Weise von den Schrecken der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erfahren. Zunehmend spielen auch Zeitzeugen zur Geschichte der DDR eine Rolle und bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zum direkten Austausch.
Schülergruppen oder ganze Klassen erhalten zudem immer wieder Gelegenheit, an historischen Wettbewerben teilzunehmen. Auch darüber hinaus finden zahlreiche Exkursionen und Projekte, oft in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und angebunden an Jubiläen und Gedenktage, statt.
Dies alles lässt Geschichtsunterricht lebendig und anschaulich werden und zeigt unseren Schülerinnen und Schülern, dass Geschichte gegenwärtig ist.